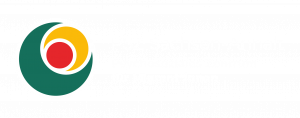Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses für Inneres und Sport,
Das Psychosoziale Zentrum für Migrantinnen (PSZ) in Sachsen-Anhalt unter Trägerschaft der St. Johannis GmbH bedankt sich für die Möglichkeit, zum Entwurf des fünften Gesetzes zur Änderung des Aufnahmegesetzes des Landes Sachsen-Anhalt Stellung nehmen zu dürfen. In Anbetracht des kurzen Zeitraums zur Auseinandersetzung mit dem Änderungsvorschlag und der Gesetzesgrundlage können wir an dieser Stelle nur zu bestimmten, aus unserer Sicht aber zentralen Punkten Stellung nehmen.
Das PSZ Sachsen-Anhalt begrüßt die Zielsetzung des Gesetzgebers, den geltenden europarechtlichen Regelungen der Aufnahme-Richtlinie (Richtlinie 2013/33/EU) Rechnung zu tragen und dementsprechend Anpassungen im Landesrecht vorzunehmen.
Das PSZ Sachsen-Anhalt ermöglicht psychisch erkrankten, traumatisierten Flüchtlingen eine sprachmittlungsgestützte, transkulturelle psychosoziale Beratung und Therapie. Hauptzielgruppe unserer Arbeit sind Geflüchtete, die Verfolgung, Gewalt und Folter erlebt haben. Demnach ist das PSZ eine Versorgungseinrichtung für besonders schutzbedürftige Geflüchtete, die anderweitig aktuell nicht die bedarfsgerechte und notwendige Versorgung erhalten können.
Aus Sicht des PSZ Sachsen-Anhalt ist die Grundvoraussetzung für eine adäquate Umsetzung des Aufnahmegesetzes im Sinne der EU-Richtlinien eine systematische, landesweite und frühzeitige Identifizierung von besonders schutzbedürftigen Personen innerhalb der Schutzsuchenden.
Zu §1 Abs. 2, Punkt dd): „Die Landkreise und kreisfreien Städte sollen geeignete Maßnahmen treffen, um bei der Unterbringung den Schutz von Frauen und schutzbedürftigen Personen zu gewährleisten.“
Es ist zu begrüßen, dass bei der Unterbringung der Schutz von Frauen und schutzbedürftigen Personen gewährleistet werden soll. Hierbei soll an dieser Stelle betont werden, dass diese Vorgabe für alle unter Art. 21 der Aufnahmerichtlinie aufgeführten Personengruppen Anwendung finden sollte. Ein entsprechendes Gewaltschutzkonzept ist aus unserer Sicht für den Schutz von schutzbedürftigen Personen insgesamt, aber auch vor allem in Bezug auf Kinder in Unterkünften dringend geboten.
Neben dem Schutz ist aus Sicht des PSZ auch eine der Situation der jeweiligen Schutzbedürftigen angemessenen und entsprechenden Form der Unterbringung zu beachten. Neben etwa der unsicheren Aufenthaltssituation, Diskriminierung oder sozialer Isolation – um nur einige Faktoren zu nennen – findet sich auch die Wohnsituation unter den sogenannten „Post-Migrations-Stressoren“ wieder, die sich entsprechend auf die psychische Gesundheit und die Ausprägung von Traumatisierung auswirkt. Die Wissenschaft spricht hier von sequentieller Traumatisierung (Knaevelsrud, C. (2017). Sequentielle Traumatisierung von Flüchtlingen –psychosoziale Folgen und Interventionsansätze). Je nach Hintergrund der besonderen Schutzbedürftigkeit benötigt es entsprechende Angebote zur Unterbringung, was eine gewisse Flexibilität und bedarfsgerechten Ausgestaltung benötigt.
Zu §1 Abs. 5, Punkt e) (5b): „Die nach Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 6 zuständige Behörde oder von dieser beauftragte Dienstleister dürfen die Zimmer der in einer Gemeinschaftsunterkunft wohnenden Personen auch ohne deren Einwilligung betreten, wenn das Betreten zur Sicherstellung von Sicherheit und Ordnung insbesondere der Einhaltung der Nutzungsordnung in der Gemeinschaftsunterkunft erforderlich ist.“.
Neben dem Aspekt der grundgesetzlichen Unverletzlichkeit des eigenen Wohnraums möchte das PSZ noch auf einen weiteren Punkt hinweisen, der aus unserer Sicht Beachtung finden muss. (Traumatisierte) Geflüchtete, die in Deutschland angekommen sind, benötigen vor allem ein Gefühl von Sicherheit, Ruhe und Kontrollierbarkeit der Situation sowie der Möglichkeit anzukommen. Fluchtursachen und der Fluchtweg sind von Unsicherheit, Ausgeliefertsein und Ausnahmezustand geprägt. Neben diesen allgemeinen Aspekten soll an dieser Stelle, aus unserer jahrzehntelangen Erfahrung in der Arbeit mit psychisch erkrankten Geflüchteten und fachlicher Expertise, unbedingt Beachtung finden, dass das Betreten des persönlichen „Schutzraumes“ ohne Einwilligung und Absprache zu einer Re-Traumatisierung der Betroffenen führen kann und somit die Gesundheitssituation stark verschlechtert. Viele Klient*innen haben solche oder ähnliche Situationen im Heimatland oder auf der Flucht erlebt und es muss aus psychologischer Sicht unbedingt vermieden werden, dass sie solchen Erfahrungen erneut ausgesetzt werden. Die Einhaltung der Nutzungsordnung als Voraussetzung für das Betreten des Wohnraums ist aus unserer Sicht unverhältnismäßig zu den sich daraus ergebenden Folgen für die Betroffenen. Wir haben in der Praxis Klient*innen, die durch ebensolches Vorgehen retraumatisiert wurden. Vielmehr sollte eine traumasensible und –pädagogische Schulung von Mitarbeiter*innen in den Unterkünften in den Blickpunkt genommen werden.
Zusätzlich muss bei der Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben auch eine Konkretisierung des §1 Abs. 2 Beachtung finden: „Zur Aufnahme im Sinne von Absatz 1 gehören Unterbringung und bei Bedarf Leistungen nach den jeweils maßgebenden Leistungsgesetzen, …“. Folgend werden geltende europarechtliche Vorgaben (Richtlinie 2013/33/EU) aufgeführt, die hierbei in der Umsetzung berücksichtigt werden müssen:
Artikel 19 Medizinische Versorgung, Abs. 2: „Die Mitgliedstaaten gewähren Antragstellern mit besonderen Bedürfnissen bei der Aufnahme die erforderliche medizinische oder sonstige Hilfe, einschließlich erforderlichenfalls einer geeigneten psychologischen Betreuung“.
Artikel 23 Minderjährige, Abs. 1: „Bei der Anwendung der Minderjährige berührenden Bestimmungen der Richtlinie berücksichtigen die Mitgliedstaaten vorrangig das Wohl des Kindes. Die Mitgliedstaaten gewährleisten einen der körperlichen, geistigen, seelischen, sittlichen und sozialen Entwicklung des Kindes angemessenen Lebensstandard“.
Artikel 25 Opfer von Folter und Gewalt, Abs. 1: „Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Personen, die Folter, Vergewaltigung oder andere schwere Gewalttaten erlitten haben, die Behandlung — insbesondere Zugang zu einer adäquaten medizinischen und psychologischen Behandlung oder Betreuung — erhalten, die für den Schaden, welcher ihnen durch derartige Handlungen zugefügt wurde, erforderlich ist“.
Nach einer systematischen Identifizierung von besonders schutzbedürftigen Geflüchteten ist eine den eben aufgeführten Vorgaben entsprechende Anwendung in der Auslegung der „Leistungen nach den jeweils maßgebenden Leistungsgesetzen“ zwingend zu berücksichtigen. Dies kann und sollte aus Sicht des PSZ Sachsen-Anhalt in Form von Kostenübernahmen der jeweils zuständigen Leistungsbehörden für die notwendige medizinische und psychosoziale Versorgung geschehen. Einer flächendeckenden Identifizierung von besonders schutzbedürftigen Geflüchteten muss eine gesicherte Finanzierung der sich daraus ergebenden notwendigen, adäquaten und bedarfsgerechten Versorgung folgen. Obwohl das PSZ Sachsen-Anhalt mit seinen drei Standorten in Halle(Saale), Magdeburg und Stendal mittlerweile flächendeckende psychosoziale Versorgung im Bundesland ermöglicht, stehen Kapazitäten und Nachfrage in keinem Verhältnis, auch weil wir immer noch die einzige Institution sind, die transkulturelle, sprachmittlungsgestützte, psychosoziale Therapie und Versorgung anbietet. Die Wissenschaft geht davon aus, dass etwa ein Drittel der Schutzsuchenden psychisch erkrankt sind. Eine zeitnahe und angemessene Versorgung ist dringend geboten, um Chronifizierungen von Krankheitsbildern und einer sich daraus ergebenden langfristigen Beeinträchtigung zu vermeiden (BPtK-Standpunkt: Psychische Erkrankungen bei Flüchtlingen. 2015). Präventive, ambulante Angebote sind einer Notfallversorgung durch Kliniken – auch aus Kostengründen – vorzuziehen.
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen

Martin Kampa
(Projektleitung)